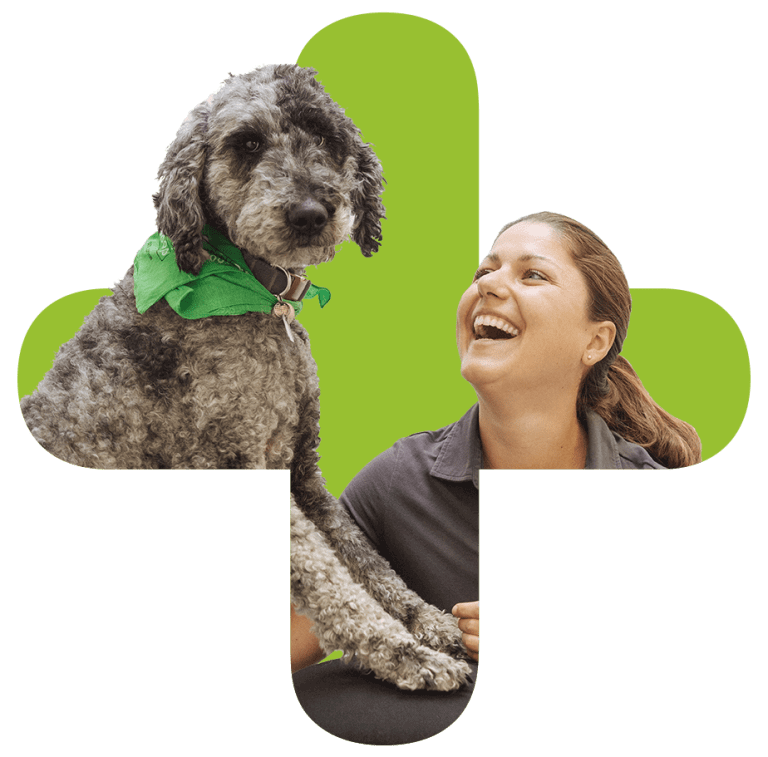Plattenepithelkarzinom des Pferdes
Entstehung, Formen, Behandlung
Was ist ein Plattenepithelkarzinom?
Wie erkenne ich ein Plattenepithelkarzinom?
Wo tritt das equine Plattenepithelkarzinom am häufigsten auf?


Okuläre Plattenepithelkarzinome


Kutane Plattenepithelkarzinome
Ähnliche Veränderungen können auch um den Analkegel und im Anogenitalbereich auftreten. Auch hier ist der äußerlich sichtbare Anteil oft klein.


Weitere Lokalisationen
Häufiger sind Plattenepithelkarzinome am Schlauch. Hier können sie im gesamten Bereich von der Penisspitze bis weit in die Schlauchtasche hinein auftreten und in manchen Fällen das Ausschachten vollständig verhindern. Eine gelegentliche Kontrolle der Genitalien sollte durchgeführt werden, um frühzeitig reagieren zu können.